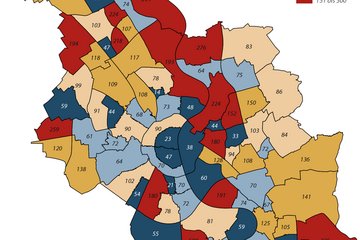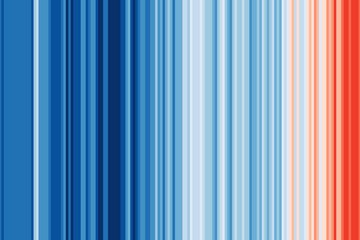„The only game in town“: Mächtige Zentralbanken und Defizite in der Wirtschaftspolitik
Leon Wansleben
Standpunkt

Zentralbanken sind zu den dominanten Akteuren der Wirtschaftspolitik in allen hochentwickelten Ökonomien geworden. Kennzeichen dieser Dominanz sind ihre starke Unabhängigkeit, ihre enormen Bilanzen, die zunehmende Aufmerksamkeit der Medien und ihre eindeutige Führungsrolle, wenn es um die Bekämpfung finanzieller und konjunktureller Krisen geht. Diese Führungsrolle steht spätestens seit dem Gipfel der G20-Staaten in Toronto 2010 außer Zweifel, als die Regierungschefs ihre fiskalpolitischen Interventionen weitestgehend einstellten. Innenpolitische Auseinandersetzungen (wie in den USA) oder zwischenstaatliche Konflikte über Krisenverantwortung und Kostenlasten (wie in der Eurozone) hatten dazu geführt. Seitdem haben Zentralbanken in mehreren Wellen Zinssenkungen, Anleihekäufe und „Forward Guidance“, eine Selbstverpflichtung zu langfristig expansiven Maßnahmen, durchgeführt. Diese Maßnahmen haben das Ziel, Wachstum zu stimulieren, Deflation zu vermeiden und die Kreditmärkte zu stabilisieren.
Die öffentliche Debatte und die sozialwissenschaftliche Forschung zu den tieferen Ursachen und Konsequenzen dieser Zentralbankdominanz in der Wirtschaftspolitik haben gerade erst begonnen. Über die Ursachen wissen wir deshalb so wenig, weil das konventionelle Verständnis der politischen und ökonomischen Bedeutung von Geldpolitik nur bedingt zur Analyse der Entwicklung von central banking in den vergangenen zwanzig bis dreißig Jahren taugt. So ging man lange davon aus, dass Geldpolitik seit den 1980er-Jahren an Gewicht gewonnen habe, weil mächtige Interessengruppen die hohen Inflationsraten der 1970er-Jahre nicht länger tolerieren wollten und deshalb dafür sorgten, dass mit unabhängigen Zentralbanken eine Instanz geschaffen wurde, die losgelöst von Wähler- und Regierungsinteressen für „hartes Geld“ sorgen konnte.
Doch schon seit geraumer Zeit – in den USA seit Mitte der 1980er-Jahre – hat sich der Problemfokus in den entwickelten Ökonomien verschoben: Nicht sich zuspitzende Verteilungskonflikte in den industriellen Beziehungen und dadurch ausgelöste Inflation, sondern Deindustrialisierung, sinkende Realzinsen und „Finanzialisierung“ (hohes Kreditwachstum, Expansion des Finanzsektors) prägen diese Ökonomien. Die Rolle von Zentralbanken in solchen Konstellationen ist eine ganz andere als im Ausgang der Hochinflationsphase. Ihre Stabilisierungspolitik besteht heute vor allem darin, den wachsenden Finanzsektor gegen seine inhärenten Instabilitäten abzusichern und Finanzialisierungsprozesse in Krisenphasen am Laufen zu halten. Das leisten Zentralbanken, indem sie Unsicherheiten in den Märkten eindämmen, vor allem durch die Vorgabe gegenwärtiger und zukünftig erwartbarer Zinsen sowie durch das Umwandeln von privat geschöpften Krediten in hoheitliche Zahlungsmittel („Reserven“). Je mehr unsere Ökonomien durch beschleunigtes Kreditwachstum und die damit zusammenhängenden Instabilitäten geprägt sind, desto mehr gewinnen demnach Zentralbanken als auf Finanzmärkte orientierte Steuerungsinstanzen an Einfluss auf Wirtschaftspolitik.
Allmählich zeichnen sich die Folgen dieser finanzmarktorientierten Wirtschaftspolitik ab. Auch hier ist die Forschung noch spärlich, doch finden sich in der Literatur bereits zwei überzeugende Argumente. Einerseits befinden sich die westlichen Ökonomien in einer Situation von „too much finance“. Soll heißen, mehr Kredit und Kapital, nicht zuletzt ermöglicht durch die gegenwärtige Zentralbankpolitik, führt eben nicht zu mehr produktiven Investitionen, weil hierfür die Absatzchancen gar nicht vorliegen. Stattdessen beobachten wir sich selbst verstärkende Bewertungsspiralen auf Märkten für existierendes Kapital, wie etwa im Immobiliensektor oder auf Aktienmärkten. Darüber hinaus wirken die Zentralbankmaßnahmen tendenziell regressiv und so umverteilend zugunsten der Vermögenden. Diese Entwicklung verschärft das Verteilungsproblem, das eng mit den Wachstums- und Produktivitätsproblemen westlicher Ökonomien verknüpft ist.
So wichtig aber eine genauere Analyse der Ursachen und Folgen einer zentralbankdominierten Wirtschaftspolitik ist, so wenig hilfreich ist es, bei einer Kritik von Geldpolitik oder bei Forderungen für ihre stärkere demokratische Kontrolle stehen zu bleiben. Es sind ja gerade die strukturellen Handlungsbedingungen von Zentralbanken – und nicht ihre willkürliche Parteinahme für bestimmte Interessengruppen –, die eine Erklärung für die Entscheidungen der Geldpolitiker und ihre problematischen Folgen bieten. Das tieferliegende Problem ist bei den nationalen Parlamenten und Regierungen zu suchen und in der Frage, warum diese Organe ihre Autorität und Handlungskompetenz in der Wirtschaftspolitik aufgegeben haben. Denn eigentlich liegt bei diesen Akteuren die Macht, Ziele der Wirtschaftspolitik zu setzen und über die Gewichtung verschiedener wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu entscheiden. Die Selbstentmachtung der Parlamente und Regierungen wird am deutlichsten im Bereich der Fiskalpolitik: Diese wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer weniger zu Umverteilungszwecken genutzt, spielte bei der jüngsten Krisenbekämpfung lediglich eine marginale Rolle und bleibt als Instrument politischer Gestaltung weitestgehend ungenutzt.
Viele Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass Zentralbanken heute mit ihren Konzepten wirtschaftlicher Steuerung und ihren konkreten Interventionen an Legitimations- und Effektivitätsgrenzen stoßen, sodass ihre bald fünfzigjährige Phase der Einflussexpansion in den 2020er-Jahren zu Ende gehen könnte. Es ist die Aufgabe demokratischer politischer Institutionen, die experimentelle Suche nach neuen Zugängen und Instrumenten wirtschaftspolitischer Steuerung anzuleiten.