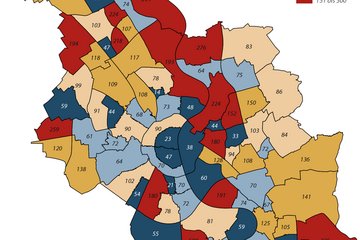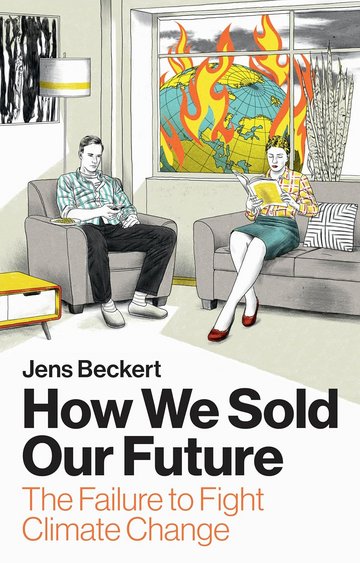Ein gutes Leben im Klimawandel? Was die Soziologie zur Bewältigung der Klimakrise beitragen kann
Christopher Schrader
Standpunkt

Die aktuellen Wetterextreme wie die Überflutungen in Deutschland im Juli 2021 haben schlagartig und aufs Neue klargemacht, wie vulnerabel auch ein reicher Industriestaat gegenüber den Folgen des Klimawandels ist. Der Bericht des Weltklimarats 2021 bestätigt aus naturwissenschaftlicher Perspektive, dass der Klimawandel menschengemacht ist, und weist eindrucksvoll darauf hin, dass die Menschheit nun noch eine letzte Chance hat zu steuern, in welchem der denkbaren Szenarien sie ankommen wird. Christopher Schrader fragt, welchen Beitrag Disziplinen wie die Soziologie hierzu leisten können.
Ist es eine gesellschaftliche Revolution oder einfach nur eine Frage technischer Innovation, wenn ein Industriestaat wie Deutschland die CO2-Emissionen innerhalb von zwei Jahrzehnten drastisch reduziert? Das hätte die interessanteste Frage werden können in den Interviews der Wochenzeitung Die Zeit mit den sechs Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Bundestagsparteien in der Ausgabe vom 8. Juli 2021. Alle sechs Gespräche folgten dem gleichen Grundgerüst, und darin hätte die Frage nach der gesellschaftlichen Revolution den Blick auf die vielfach ignorierten sozialen Rahmenbedingungen der Veränderungen gelenkt, die uns allen im Rahmen der Reaktion auf die Klimakrise bevorstehen.
Technik ist unverzichtbar, aber sie reicht nicht! Das wäre eine angemessene Antwort gewesen. Oder: Die Gesellschaft muss sich grundlegend ändern, will sie die Chance wahren, die Klimakrise einzudämmen – und sich selbst einigermaßen treu zu bleiben. Allein Janine Wissler von den Linken wagte es überhaupt, in diese Richtung zu argumentieren. Die grüne Kandidatin für das Kanzleramt Annalena Baerbock hingegen ließ den Ball liegen und antwortete: „Wenn die Politik klare Rahmenbedingungen setzt, wird eine ökosoziale Marktwirtschaft klimaneutralen Wohlstand schaffen.“
Sicherlich ist die Frage nach der gesellschaftlichen Revolution nicht einfach zu beantworten. Zunächst müsste man vermutlich klären: Wer untersucht eigentlich, wie sich eine Gesellschaft im Zeichen der Klimakrise ändern kann? Ist eine gesellschaftliche Revolution überhaupt möglich – oder wenigstens eine weitgehende Transformation? Die Antworten darauf können weder die Natur- noch die Ingenieurwissenschaften geben, die bisher die meisten Aussagen zu Ursachen, Folgen und Lösungen der Klimakrise gemacht haben. Stattdessen müssen die Geistes- und Sozialwissenschaften, und womöglich vor allem die Soziologie, dringend ihren Beitrag leisten.
»Technik ist unverzichtbar, aber sie reicht nicht.«
Die Psychologie hat dieses Problem längst aufgenommen, und ihre Antworten erhellen, warum Menschen – oft im sozialen Zusammenhang ihrer jeweiligen Gruppen und Identitäten – Botschaften über den Klimawandel akzeptieren und in Handlungsabsichten übersetzen, oder auch nicht. Das ist im Wesentlichen der Blick auf das individuelle Verhalten. Die Politikwissenschaften wiederum betrachten Institutionen, Organisationen und andere kollektive Entscheidungsprozesse. In der Mitte aber klafft eine Lücke: Wie werden aus Individuen und Kleingruppen soziale Strukturen, die gemeinsame Praktiken entwickeln, sich zu Bewegungen zusammenfinden, ihr Verhalten voreinander rechtfertigen, als kollektive Akteure handlungsfähig werden?
Nun kann und möchte ich als Journalist (und Physiker) der Soziologie keinesfalls vorschreiben, was sie zu tun hat. Im besten Fall kann ich einige Früchte selektiver Lektüre ins Licht halten und einige Aspekte nennen, von denen sich vielleicht der eine oder andere als relevant erweist. Eine zentrale Rolle scheinen mir hier Fragen zu spielen, die die Gesellschaft sich selbst nicht stellt, Annahmen, die sie nicht reflektiert, und Verhaltensweisen, die sie automatisch ablaufen lässt – die aber alle im Zeichen der Klimakrise dringend bewusst betrachtet werden müssen. Denn einerseits kann es nicht mehr einfach so weitergehen, andererseits beruhen das Verhalten, die Entscheidungen und Wünsche vieler Menschen oft auf kaum jemals auch nur bewusst ausgesprochenen oder gar hinterfragten Annahmen über das Zusammenleben und „das gute Leben“.
Die Soziologie habe sich sehr wenig mit der Frage beschäftigt, wie die Klimakrise zu bewältigen sei, sagte mir Jens Beckert bei einem Gespräch während meiner Zeit als Journalist in Residence am MPIfG im Herbst 2020. Auch Thomas Dietz, Professor für Soziologie und Umweltpolitik, und seine Co-Autoren (2020) stellen fest, dass die soziologische Theorie und Methodik noch nicht weit damit vorangekommen sind, eine detaillierte menschliche Ökologie zu entwickeln, die erfasst, wie biophysikalische Prozesse sozialen Wandel beeinflussen. Gleichzeitig formuliert der Aufsatz die Überzeugung, dass der Klimawandel eine der größten transformierenden Kräfte des 21. Jahrhunderts sein und die Soziologie wichtige Beiträge zum Verständnis dieser Veränderung leisten wird. Die Wissenschaft müsse sich dabei auf konkrete Handlungen vom Kreuz auf dem Wahlzettel bis hin zum politischen Aktivismus konzentrieren. Was Menschen tun, hänge auch davon ab, wie sie Situationen und den sozialen Kontext interpretieren. Diese Deutungen wiederum würden von Rollen, Institutionen und sozialen Netzwerken geformt.
»Eine zentrale Rolle spielen Fragen, die die Gesellschaft sich selbst nicht stellt, Annahmen, die sie nicht reflektiert, und Verhaltensweisen, die sie automatisch ablaufen lässt.«
Anita Engels, Soziologie-Professorin an der Universität Hamburg und Herausgeberin des Jahrgangs 22 des Newsletters economic sociology, bezeichnet ihr Fachgebiet hier als „ungenutzte Schatzkiste“. Für sie ist die Bewältigung des Klimawandels vor allem ein politischer Kampf, und nicht die technische Anwendung neutraler Instrumente. Die Wirtschaftssoziologie sei gut ausgestattet, diese Konflikte über Klima-Zukünfte sichtbar und verstehbar zu machen.
Konflikte im Rahmen der kommenden Veränderungen erwarten auch die Soziologen Bernd Sommer und Harald Welzer (2014): Transformation sei „mittelfristig unvermeidlich“, erklären sie – die Frage sei nur: Wird sie mit Einsicht und Vernunft gestaltet oder von den Verhältnissen erzwungen? Das Einhalten ambitionierter Klimaziele durch Senken und Beenden der Emissionen werde „nicht ohne Veränderung kultureller Praktiken auskommen“. Und Andy Hoffman (2020), Professor für nachhaltiges Unternehmertum, legt im economic-sociology-Newsletter die Latte sehr hoch: Der nötige Umbruch werde vergleichbar mit der Aufklärung werden. Der Wandel der Lebensweise brauche Unterstützung von tieferen kulturellen Vorstellungen. Dort müsse die Veränderung passieren oder es werde nicht gelingen.
Das bedeutet auch: Wie die Philosophen der Aufklärung sollten die heutigen gesellschaftlichen Akteure sehr bewusst, klar und schnell über das nachdenken und diskutieren, was wir in einer nachhaltigen Zukunft für derart selbstverständlich halten werden, dass wir es kaum mehr erwähnen. Solche Ideen zu thematisieren erlaubt es, für eine attraktive, nachhaltige Zukunft zu werben, anstatt sich in Diskussionen über Verzicht oder die Einschränkung von Freiheit aufzureiben. Allerdings ist ein solcher Umschwung auch nicht einfach „zu verkaufen“. Bisher haben allenfalls kleine, oft belächelte Gruppen die Standards und Erwartungen für sich selbst radikal umdefiniert, ohne große Außenwirkung zu entfalten. Die neue und viel größere Aufgabe besteht aber nun darin, dies für große Teile der Gesellschaft anzustoßen. Oder zumindest zu klären, wie solche plötzlichen, deutlichen Veränderungen der sozialen Entwicklung möglich werden.
Dieser Gedanke ist mir in vielerlei Gestalt immer wieder begegnet, unter anderem in den Arbeiten von Jens Beckert mit dem von ihm (2018) vorgelegten Konzept der fiktiven Zukunftserwartungen als Triebfeder des Kapitalismus. Sie erlauben es Menschen zu handeln, als ob ihre Annahmen schon erfüllt seien. Diese Erwartungen müssen dafür zwar konsistent und kontingent sein, können aber „eine radikale Abkehr von der Gegenwart darstellen und eine kreative und stimulierende Kraft der Wirtschaft werden“, so Beckert. Die Erwartungen seien nämlich „nicht auf eine empirische Realität beschränkt“.
Was das im Zusammenhang mit ökonomischen oder ökologischen Schocks bedeuten kann, haben Lisa Suckert und Timur Ergen (2021) vom MPIfG vor Kurzem am Beispiel der Ölkrise von 1973 untersucht. Aber genauso gut könnte dies für die Analyse der Klimakrise gelten: Bei solchen Konflikten und Wegentscheidungen spielen Wahrnehmung und Deutung ökologischer Schocks eine zentrale Rolle. Wirken die Folgen des Klimawandels als Katastrophe oder werden sie so erklärt, dann erscheinen sie unvermeidbar und einmalig; solche rhetorischen Figuren zeigten sich zum Beispiel deutlich in den Äußerungen des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet nach den Überflutungen in NRW im Juli 2021. Werden die Ereignisse hingegen als Krise erfahren, oder genauer: „sozial konstruiert“, sodass sich ein gemeinsames Verständnis der Ursachen, Folgen und möglichen Lösungen ausbildet, dann eröffnen sich gesellschaftliche Handlungsoptionen. Es brauche komplexe soziale Prozesse, so Suckert und Ergen, damit ein Abweichen von den gewohnten Pfaden der Vergangenheit vorstellbar, möglich und vernünftig wird. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Erwartung, dass die Zukunft ganz anders werden muss, als es eine Fortsetzung bisheriger Trends nahelegt.
»Werden Ereignisse als Krise erfahren, eröffnen sich gesellschaftliche Handlungsoptionen.«
Sicherlich wird ein solcher Richtungswechsel nicht einfach – weder zu begründen noch durchzusetzen. Das zeigt auch Donella Meadows’ Liste der zwölf Hebelpunkte, an denen man in die Funktion komplexer Systeme eingreifen kann (1999). Weit oben, wo die Hebel wie auch die Beharrungskräfte im System sehr groß sind, siedelt die Systemtheoretikerin die Veränderung der „Paradigmen“ an: der unausgesprochenen Überzeugungen, Zwecke und Gewohnheiten. Sie beruhen nach Meadows auf einer geteilten sozialen Übereinkunft über das Wesen der Realität, werden als offensichtlich angesehen und im Normalfall nicht hinterfragt.
Einen ähnlichen Gedanken findet man bei Pierre Bourdieu im Begriff „Doxa“, den der französische Soziologe für „alle Meinungen, deren Gültigkeit fraglos vorausgesetzt wird“, verwendete (Koller 2014). Sie äußern sich in gemeinsamen sozialen Praktiken und bisweilen auch in der Infrastruktur. Ein Beispiel ist die Stellung des Autos im Verkehr und der Gesellschaft. Solche unreflektierten Annahmen aber können in einer Krise durchaus hinterfragt werden. Was sich dann wandelt, reicht tief in den Alltag hinein, aber auch darüber hinaus: Die Soziologinnen Elisabeth Shove und Nicola Spurling (2013) erkennen entsprechend die Aufgabe darin, sich Versionen des normalen Lebens vorzustellen und zu realisieren, die in die Vorgaben der Nachhaltigkeit passen. In diesem Rahmen müsse man radikal umdefinieren, was als normale soziale Praxis gilt und wie die Institutionen und Infrastrukturen funktionieren, auf denen sie beruht. Auch Sighard Neckel (2021), Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel, sieht diese beiden Ebenen: „Jeder Systemwechsel, auch ein ökologischer, bedarf zu seiner Realisierung der Verankerung in den Alltagswelten der Menschen.“ Doch es gehe dabei nicht nur um „Routinen und Gewohnheiten auf der Subjektseite“. Veränderungen dort müssten sich auch mit „Standards, Konventionen, Möglichkeiten und Infrastrukturen auf der Seite von Märkten, Institutionen und Funktionssystemen verschränken“.
Dies sind nur kurze Ausschnitte der vielfältigen Ansätze, mit denen Soziologinnen und Soziologen die Klimakrise thematisieren. Sie sollen zeigen, dass ihre Wissenschaft wertvolle Impulse für die Bewerkstelligung gesellschaftlicher Transformation angesichts der Klimakrise geben kann – eine Transformation, die längst begonnen hat, aber in verträgliche und friedliche Bahnen gelenkt werden muss. Die dringend gesuchten Wege, um die unvermeidbaren Veränderungen anzustoßen und umzusetzen, lassen sich nur finden, wenn die Menschen dieses Landes gemeinsam den gesellschaftlichen Wandel angehen. Nur so gelingt vielleicht am Ende eine gesellschaftliche Revolution im besten Sinne, auf der Basis eines neuen Konsenses über das „gute Leben“.