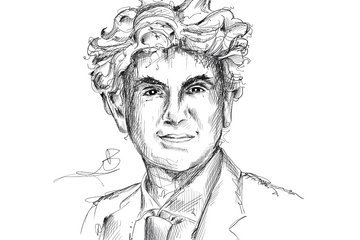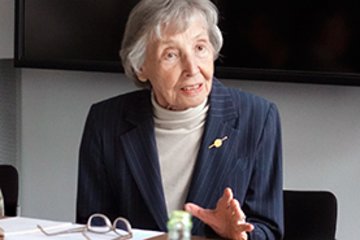Verhandlungsbühnen und Machtdynamiken: Ein soziologischer Blick auf die Klimaverhandlungen
Hannah Pool
Hannah Pool, wissenschaftliche Mitarbeiterin am MPIfG, hat als Leiterin einer Beobachter-Delegation der Max-Planck-Gesellschaft an der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) in Baku teilgenommen. Gemeinsam mit zwei Kollegen verfolgte sie zwei Wochen lang die Verhandlungen über den Fonds für Schäden und Verluste sowie die Debatten über Menschenrechte und Gesundheitsrisiken des Klimawandels. Hier schildert sie ihre Eindrücke und Gedanken.
Die Bilder, die von den UN-Klimakonferenzen (COP) medial in die Welt getragen werden, sind stets dieselben – egal, wo die jährlichen Klimaverhandlungen stattfinden: Zu Beginn sieht man die Aufnahmen der Eröffnungsreden von Staatsoberhäuptern, bald abgelöst von der Übertragung von Protesten – hauptsächlich von jungen Menschen, die auf dem UN-Gelände die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Erderwärmung aus dem Pariser Klimaabkommen einfordern. Zum Abschluss dann Bilder der körperlich erschöpften, übermüdeten Verhandlerinnen und Verhandler, die nach zwölf bis vierzehn Tagen einen ununterbrochenen Verhandlungsmarathon in den Knochen haben. Am Ende müssen sie noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um die letzten Änderungen auszuhandeln. Hinter diesen sich jährlich wiederholenden Aufnahmen offenbart sich den beobachtenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedoch ein regelrechter Schauplatz der Aushandlungsprozesse. Dieser ist geprägt von Zehntausenden Akteuren, die sich in unterschiedlichen räumlichen Sphären bewegen und austauschen.
»Nur wenige internationale Konferenzen sind so transparent und zugänglich wie die COP-Klimaverhandlungen.«
Nur wenige internationale Konferenzen sind für eine Vielzahl von Akteuren und Akteurinnen so transparent und zugänglich wie die COP-Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen. Teil der Ordnung der Weltklimakonferenzen ist es, dass Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen und Interessengruppen anwesend sein dürfen, um zu protokollieren und zu dokumentieren – und somit maßgeblich zur Schaffung von Transparenz und Verantwortlichkeit beizutragen. Neben den staatlichen Delegationen und den Medienvertretungen sind auch die YOUNGO (Jugendvertretung), die BINGO (Vertretung von Wirtschaftsakteuren) und die RINGO (Repräsentation der Forschung) vor Ort gut sichtbar.

In dieser Rolle ist auch die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) als Mitglied der RINGO als Beobachterin bei den COP-Klimakonferenzen vertreten. Obwohl die MPG nicht beratend tätig ist, hat die Forschung an vielen ihrer Institute entscheidend zu unserem heutigen Wissen über den Klimawandel beigetragen. Die von der MPG zu den Klimaverhandlungen entsandten Delegationen verfolgen aus wissenschaftlichem Interesse die Verhandlungen und werden jährlich neu zusammengesetzt. So bestanden in der Vergangenheit diese Delegationen aus Forschenden in den Bereichen Recht, Physik, Anthropologie, die sich für die Entwicklung, die Verfahrensweise und die Abläufe der Verhandlungen interessieren.
Aus einer wirtschaftssoziologischen Perspektive ist besonders interessant, wie Macht in den verschiedenen „Räumen“ der COP zeitgleich ausgehandelt, justiert und neu definiert wird. Die COP-Verhandlungen bilden einen Mikrokosmos, der sich über zwei Wochen hinweg entwickelt und dabei jährlich Elemente der Wiederholung in sich trägt. Die Akteurinnen und Akteure sind dabei stets durch die Räume getrennt, in denen sie sich aufhalten: Einerseits gibt es die „Green Zone“, die vom gastgebenden Land organisiert wird und in der Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsstrategien präsentieren – oder auch „Greenwashing“ betreiben. Zur Erforschung von grüner Technologie, Selbstdarstellung, Zukunftsnarrativen und wirtschaftlicher Vernetzungen ist dieser Bereich für sich allein ein faszinierendes Forschungsfeld.
»Die Setzung eines einzelnen Kommas veränderte den Ausdruck der historischen Verantwortung einiger Staaten.«
Politisch relevant ist die „Blue Zone“, in der die eigentlichen Verhandlungen stattfinden. In diese Verhandlungsräume dürfen auch Beobachterinnen und Beobachter eintreten, jedoch nur, soweit Platz verfügbar ist. Die Verhandlungen sind technischer Natur: Der Vertragstext wird in einem Word-Dokument mit der Funktion „Änderungen nachverfolgen“ an die Wand projiziert. Reihum melden sich dann die befugten staatlichen Verhandlerinnen und Verhandler zu Wort, um die Wörter in eckigen Klammern zu diskutieren und anzufechten. In dieser detaillierten Abstimmungsarbeit über jedes Wort und Satzzeichen werden staatliche Verantwortung, Allianzen und Selbstverständnis austariert.
So wurde in der ersten Woche der COP29-Verhandlungen, die im November 2024 in Baku in Aserbaidschan stattfanden, freitags bis spät in die Nacht immer noch über die Setzung eines einzelnen Kommas diskutiert. Es ging dabei um die Frage, ob „indigenous people“, also die indigenen Bevölkerungen vieler vom Klimawandel betroffener Staaten, als Stakeholder oder als Rechtssubjekte betrachtet werden sollen. Die Setzung eines einzelnen Kommas – vor oder nach dem Nomen – machte hierbei den Unterschied und veränderte den Ausdruck der historischen Verantwortung einiger Staaten. Der Schlagabtausch zwischen den nationalen Delegationen führte mancherorts zu einem Augenrollen angesichts der um 23 Uhr einsetzenden Erschöpfung. Im Kern bedeutete dies jedoch, dass hier jahrhundertelang bestehende Ungerechtigkeiten neu bewertet und in internationales Recht überführt werden sollten.

Außerhalb der Verhandlungssäle befindet sich ein weiterer, oft unbeachteter Marktplatz politischen Einflusses: die Pavillons der Staaten. Alle Staaten haben die Möglichkeit, Messeflächen anzumieten, um sich selbst und ihre Nachhaltigkeitsstrategien vorzustellen, Veranstaltungen zu organisieren und Delegationen anderer Staaten zu empfangen. In diesem Bereich findet das Agenda-Setting statt. Auch internationale Organisationen versuchen, ein Programm auf die Beine zu stellen, um ihre wichtigen Themen auf die Tagesordnung der offiziellen Sitzungen zu bringen.
Die COP29 in Baku unterschied sich in mehreren Aspekten deutlich von der COP28 in Dubai im Vorjahr. Auffällig aus soziologischer Sicht waren insbesondere die unterschiedlichen Aufmerksamkeitsökonomien: Während die COP in Dubai als internationale Bühne für globale Wirtschaftseliten fungierte und ein breites Medienecho erhielt, wurde der COP29 in Baku deutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil. Es wurden bewusst weniger Observer-Badges – Akkreditierungen für Personen mit Beobachter-Status – ausgestellt, und das allgemeine Interesse am Thema Klimawandel hatte wenige Tage nach der Wahl von Donald Trump in den USA bereits spürbar nachgelassen. Die geringere Teilnehmerzahl von knapp 40.000 Personen im Vergleich zu der überwältigenden Zahl von über 85.000 Menschen bei der COP in Dubai wurde von den Organisatoren vielleicht als Chance für effizientere Verhandlungen gesehen.
»Besorgniserregend: Das Interesse an der Bekämpfung des globalen Klimawandels unter dem Dach der UN hat abgenommen.«
Aus der Perspektive einer wissenschaftlichen Organisation ist diese Entwicklung jedoch besorgniserregend: Das Interesse an der Bekämpfung des globalen Klimawandels und das Engagement für international gültige Klimaabkommen im Kontext der Klimakonferenzen unter dem Dach der UN haben abgenommen. Das Forum der COP stellt jedoch durch die Teilnahme aller Staaten, die Präsenz einer lauten und kritischen Zivilgesellschaft sowie einer beobachtenden Wissenschaft eine Verhandlungsarena von unschätzbarem Wert dar. Gerade hier wird die internationale Zusammenarbeit in einer Angelegenheit greifbar, die den gesamten Planeten und die Heimat aller Menschen betrifft.
Und während die Fossil-Fuel-Lobby und die stärksten Industriestaaten viele Möglichkeiten der Vernetzung und des Austausches haben, sind es vor allem die Akteure der Zivilgesellschaft sowie die am stärksten betroffenen Staaten, die auf die Wichtigkeit verbindlicher, allgemein geltender und weitreichender COP-Klimaverhandlungen drängen. Zu diesen gehören etwa die pazifischen und karibischen Inselstaaten und die Länder, die historisch am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Bei der COP29 in Baku wurde dies am Auftreten der Verhandlungsgruppe der Least Developed Countries gut sichtbar: Sie waren es, die aus Protest gegen das unzureichende Abkommen den Saal verließen. Sie waren es jedoch auch, die zurückkehrten, um dennoch – so ungenügend und unbefriedigend es auch für sie als am meisten betroffene Akteure ist – ein Abkommen abzuschließen.
Es ist bezeichnend, dass gerade die Verhandlungsgruppe der Least Developed Countries die COP als Instrument für internationale Klimapolitik maßgeblich stützt. In Zeiten, die von zunehmenden geopolitischen Spannungen geprägt sind, bekennen sich diese rund 46 Staaten zur COP als Forum für multilateralen Dialog – trotz aller Unzulänglichkeiten. Sie bewahren damit für die globale Gemeinschaft die beste Chance auf Klimapolitik in einer Verhandlungsarena, in der 198 Vertragsparteien miteinander kooperieren müssen. Auch wenn die Fortschritte mit Blick auf die selbstgesteckten Ziele viel zu klein sind, gibt es auch künftig keine gangbare Alternative, solange Diplomatie das Leitprinzip sein soll.