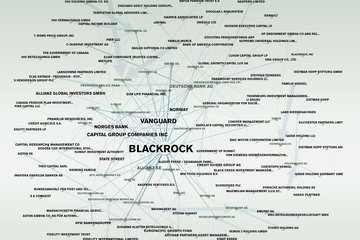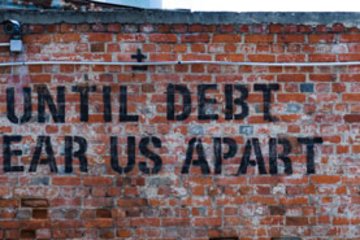Regieren in komplexen Systemen:
Fritz W. Scharpf zum 90. Geburtstag
Arthur Benz
Am 12. Februar 2025 ist Fritz W. Scharpf, Direktor Emeritus des MPIfG, 90 Jahre alt geworden. Er hat mit seinen Arbeiten zum Föderalismus, zur Europäischen Union, zur Demokratietheorie sowie auf den Gebieten der Verwaltungs- und Policy-Forschung die Politikwissenschaft seit den 1970er-Jahren maßgeblich geprägt. Durch seine Mitwirkung in verschiedenen Kommissionen fand seine Forschung immer wieder Eingang in die Politikberatung. Arthur Benz blickt auf sein herausragendes wissenschaftliches Werk und Wirken.
Fritz W. Scharpf zählt zu den bedeutendsten Sozialwissenschaftlern der Gegenwart, dies belegen zahlreiche Auszeichnungen und Würdigungen seiner Forschung – zuletzt die Ehrung für sein Lebenswerk durch die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW). Mit seiner multidisziplinär angelegten Policyforschung, die von seinen profunden Kenntnissen der Rechts und Wirtschaftswissenschaften und seinem Interesse für mathematische Modellierung profitierte, hat er die politikwissenschaftliche Forschung über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Er eröffnete neue Perspektiven auf das Politische in Verwaltung, Rechtsprechung und Wirtschaft sowie auf das Regieren in komplexen Systemen und verhalf der Policyforschung, sich zu einer Teildisziplin der Politikwissenschaft zu etablieren und deren Praxisrelevanz zu steigern. Dies gehört zu Scharpfs wesentlichen Verdiensten.
»Scharpf verortete sein Verständnis einer effektiven und legitimen Politik ›zwischen Utopie und Anpassung‹.«
Ende der 1960er-Jahre, als die ideen- und institutionenzentrierte Politikwissenschaft durch neomarxistische und systemtheoretische Ansätze herausgefordert wurde, verortete Scharpf sein Verständnis einer effektiven und legitimen Politik „zwischen Utopie und Anpassung“. Ihm waren sowohl abstrakte Krisenszenarien als auch unrealistische Reform- oder Demokratisierungsforderungen fremd. Schon seine ersten politikwissenschaftlichen Publikationen lassen die Grundzüge seiner „problem- und interaktionsorientierten Policyforschung“ erkennen, deren begriffliche Werkzeuge er zunächst in empirischen Untersuchungen entwickelte, bevor er sie 1997 in systematisch ausgearbeiteter Fassung publizierte. Scharpfs analytisches Vorgehen schärfte das Verständnis von Effektivitäts- oder Legitimationsdefiziten in verschiedenen Bereichen: der politischen Planung in der Ministerialverwaltung, der Bund-Länder-Koordination, der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik sowie der europäischen Politik. Die beobachteten Ursachen und Folgen dieser Defizite verdichtete er zu theoretischen Modellen, die die Bedingungen des Erfolgs und des Scheiterns von Prozessen kollektiven Handelns erklären.
Ein Beispiel dafür ist das Konzept der „negativen und positiven Koordination“, das Scharpf aus Untersuchungen zur Ministerialverwaltung herleitete. Es bezeichnet bestimmte Interaktionsmuster, nach denen Beamte Schnittstellenaufgaben in einer nach Politikbereichen gegliederten Regierungsorganisation erledigen: Während bei negativer Koordination ein Entscheidungsvorschlag lediglich an Einwände aus tangierten Arbeitsbereichen angepasst wird, stellen bei positiver Koordination alle Akteure ihre Vorschläge gleichzeitig zur Disposition. Letzteres erhöht zwar die Chancen für eine innovative Politikgestaltung, steigert aber auch die Komplexität und das Konfliktniveau. Die Bedeutung dieser Konzepte wurde durch nachfolgende Studien in der Policy- und Verwaltungsforschung bestätigt, insbesondere durch eine von Fritz Scharpf und Matthias Mohr durchgeführte Simulation, in der sich die Kombination beider Verfahren als vorteilhaft erwies.
»Das Hauptproblem der Politikverflechtung liegt nicht in der Blockade von Entscheidungen, sondern in einer Politik, die Verteilungskonflikten ausweicht.«
Die Konturen dieses Forschungsansatzes, der später als „akteurzentrierter Institutionalismus“ große Beachtung fand, zeigten sich noch deutlicher in Scharpfs Forschung zur Politikverflechtung. Er erklärte überzeugend die viel beklagten Defizite im kooperativen Föderalismus der Bundesrepublik und der Agrarpolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wenn institutionelle Regeln die Regierungen zwingen, sich zu einigen, lassen sich Verteilungskonflikte kaum lösen. Das Hauptproblem der Politikverflechtung liegt aber nicht in der Blockade von Entscheidungen, sondern in einer Politik, die Verteilungskonflikten ausweicht und so ihre Aufgaben nicht effektiv erfüllt – das war Scharpfs zentrale Erkenntnis. Die eigentliche Blockade betrifft institutionelle Reformen, die zwar den Konsenszwang aufheben könnten, aber auch Macht umverteilen. Da sich Regierungen darüber schwerlich einigen, befinden sie sich in der Politikverflechtungsfalle.
Scharpfs Diagnose der Politikverflechtungsfalle fand breite Resonanz – sowohl in der deutschen und der vergleichenden Föderalismusforschung als auch in der Europaforschung. Sie stimulierte die systematische Suche nach Wegen, die institutionellen Grenzen des Regierens zu umgehen. Scharpf selbst gab in seiner Theorie der Politikverflechtung den Anstoß zu dieser Forschung, indem er erklärte, dass strategisch handelnde Akteure durch geschickte Agenda-Gestaltung Blockaden vermeiden können. In seinen späteren Untersuchungen des Regierens in Europa erweiterte er diesen theoretischen Rahmen um Varianten des Mehrebenen-Regierens, um zu erklären, warum die europäische Integration sich zwar dynamisch, aber asymmetrisch entwickelt hat. Sehr kritisch betrachtete Scharpf das Ungleichgewicht zwischen der weitreichenden Marktliberalisierung durch Recht (negative Integration) und der schwachen Koordinierung der Sozial- und Umweltpolitik der Mitgliedstaaten (positive Integration) – nicht nur, weil es die Effektivität des Regierens beeinträchtigt, sondern auch wegen des Defizits an demokratischer Legitimität. Seine Vorschläge zur Überwindung dieser Defizite haben die Diskussion über eine Differenzierung der europäischen Integration bereichert.
Das Konzept der Politikverflechtungsfalle („Joint-Decision Trap“) gehört zu den wichtigen Begriffen der deutschsprachigen und internationalen Politikwissenschaft und fand entsprechend Einzug in einschlägige Lexika und Handbuchartikel. Zahlreiche Fachkolleginnen und -kollegen haben die damit verbundene Theorie aufgegriffen, kritisch reflektiert und weiterentwickelt. Scharpf prägte so die vergleichende Forschung zum Föderalismus und zu Multilevel Governance nachhaltig.

Das gilt vor allem im Hinblick auf den kompletten „akteurzentrierten Institutionalismus in der Policyforschung“, in dem Scharpf die in seiner empirischen Forschung entwickelten Erklärungsmodelle in einem kohärenten Analyserahmen zusammenfasst. Dieser analytische Rahmen basiert auf vier Säulen: (1) einer Unterscheidung von individuellen, kollektiven und korporativen Akteuren, (2) der spieltheoretischen Modellierung von Interaktionsproblemen, (3) der differenzierten Erklärung von Anpassungs-, Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen sowie (4) der Erfassung von strukturellen Bedingungen als Anarchie, Netzwerke und Institutionen. Diese theoretischen Konzepte und Erklärungsmodelle ermöglichen genaue Aussagen über verschiedene Prozesse des Policymaking, die sowohl der Komplexität politisch-administrativer Realität gerecht werden als auch Generalisierungen zulassen. In der internationalen Policyforschung erweist sich der akteurzentrierte Institutionalismus bis heute als der konzeptionell differenzierteste und in seiner begrifflichen Klarheit herausragendste Ansatz, der theoretische Präzision mit empirischer Anwendbarkeit verbindet.
»Die Lösung von Verteilungskonflikten betrachtet Scharpf als die zentrale Herausforderung politischen Handelns.«
In seinen scharfsinnigen Analysen geht es Scharpf weniger darum, zu erklären, warum Politik funktioniert, sondern warum sie nicht so funktioniert, wie sie sollte. Seine kritische Perspektive beruht auf normativen Maßstäben der Effektivität und Legitimität, anhand derer er konkrete Politik und Politikergebnisse bewertet. Die Lösung von Verteilungskonflikten betrachtet er dabei als zentrale Herausforderung politischen Handelns: Politik gilt als effektiv, wenn Entscheidungen nicht blockiert werden und zugleich zu gerechten Verteilungen führen. Legitimität setzt in Scharpfs Verständnis einerseits effektive Politik voraus, andererseits aber auch die Zustimmung der von politischen Entscheidungen Betroffenen, also der Bürgerinnen und Bürger eines politischen Gemeinwesens.
Je intensiver sich Scharpf mit den Herausforderungen des Regierens im entgrenzten Kapitalismus befasste, desto stärker rückte die Frage nach der demokratischen Legitimität in den Fokus seiner Policyforschung. Dies zeigen bereits seine vergleichenden Untersuchungen zur politischen Ökonomie der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, noch deutlicher aber seine Analysen der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Aufbauend auf seinen früheren Arbeiten zur Europäischen Union beschreibt er institutionelle Grenzen politischer Steuerung auf nationaler wie europäischer Ebene. Seine Kritik zielt hier primär auf die erzwungene Anpassung der südeuropäischen Mitgliedstaaten an die europäische Austeritätspolitik und die ungleiche Verteilung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Kosten der Eurokrise. Diese Entwicklung betrachtet Scharpf als demokratiepolitisches Desaster, das durch die Dominanz der Exekutive im politischen System der EU und die Rigidität des Primärrechts verschärft wird.
»Scharpf formulierte schon früh eine ›komplexe‹ Demokratietheorie, die normativ anspruchsvoll, aber nicht utopisch, und pragmatisch, aber nicht systemkonform sein sollte.«
Seine normative Leitidee der demokratischen Legitimität entwickelte Scharpf bereits im Mai 1969 in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Konstanz. Er unterschied dabei zwischen Output-orientierten Demokratietheorien, nach deren Verständnis institutionelle Bedingungen effektives und rationales Regieren fördern, und Input-orientierten Demokratietheorien, die politische Herrschaft durch Interessenvermittlung und Partizipation an den Willen einer aktiven Bürgerschaft binden wollen. Auf dieser Grundlage formulierte er eine „komplexe“ Demokratietheorie, die normativ anspruchsvoll, aber nicht utopisch, und pragmatisch, aber nicht systemkonform sein sollte. Demokratie bedeutet für Scharpf eine zeitlich begrenzte Herrschaft von gewählten Repräsentanten, die sich um das Gemeinwohl bemühen (Output-Legitimität). Dieses lässt sich allerdings nicht direkt aus einem Wählerauftrag ableiten. Vielmehr müssen die Regierenden antizipieren, was die Betroffenen oder die Mehrheit der Bürgerschaft als Gemeinwohl akzeptieren und später in ihrem Wahlverhalten ausdrücken werden. Gemeinwohlvorstellungen, die auf konkrete Aufgabenfelder bezogen sind, können Regierende aus öffentlichen Diskussionen in verschiedenen Foren gewinnen, etwa in Medien, Parteien, Verbänden oder zivilgesellschaftlichen Organisationen (Input-Legitimität). Sie handeln entsprechend, weil sie sich der Parteienkonkurrenz stellen und ihre Entscheidungen gegenüber der Wählerschaft verantworten müssen.

Scharpf nutzt diese komplexe Demokratietheorie, um die Chancen und Grenzen der Legitimität europäischer und internationaler Politik zu bestimmen. In seinem Standardwerk „Demokratietheorien“ hob der Politikwissenschaftler Manfred G. Schmidt die überragende Qualität und das Entwicklungspotenzial von Scharpfs Ansatz hervor. Zwar räumte Fritz W. Scharpf anlässlich der Verleihung des Lebenswerkpreises der DVPW ein, sich lange Zeit vorrangig mit Fragen der Effektivität von Politik und Verwaltung befasst zu haben. Doch seit jeher interessierte er sich auch für die Spannung zwischen den Anforderungen an effektive und demokratische Politik als eine grundlegende Herausforderung des komplexen Regierens, mit der er sich in konstruktiver Absicht wissenschaftlich beschäftigte.
Scharpfs demokratietheoretisch fundierte Policyforschung erweist sich angesichts der aktuellen Krisen der Demokratie und der globalen politischen Ordnung als bedeutsamer denn je. Sie liefert das analytische Werkzeug, um die Ursachen dieser Entwicklungen besser zu verstehen, und kann Wege aufzeigen, wie gemeinwohlorientierte Politik Probleme lösen und Institutionen reformieren kann – aber auch, um zu erkennen, wo die Grenzen dieser Politik liegen. Sie definiert normative Maßstäbe, um Politik jenseits von Utopie und Anpassung zu bewerten. Der Scharpf’sche Ansatz hat Generationen von Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern geprägt und wird auch zukünftig Forschende in dieser Disziplin inspirieren, denn die Potenziale seiner Theorie sind noch keineswegs ausgeschöpft.
»Scharpfs Arbeiten liefern das analytische Werkzeug, um die Ursachen der aktuellen Krisen der Demokratie besser zu verstehen.«
Fritz W. Scharpf
Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und Politischen Wissenschaft in Tübingen, Freiburg und Yale mit anschließender Promotion begann Scharpf seine akademische Karriere 1964 als Assistant Professor of Law in Yale. 1968 folgte er einem Ruf an die Universität Konstanz auf eine Professur für Politikwissenschaft. Von 1973 bis 1984 leitete Scharpf als Direktor das Internationale Institut für Management und Verwaltung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Durch seine Mitarbeit in verschiedenen politischen Kommissionen fand seine Forschung seit den Siebzigerjahren immer wieder Eingang in die Praxis. 1986 wurde er als zweiter Direktor an das ein Jahr zuvor gegründete Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIfG) in Köln berufen. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 gestaltete er maßgeblich die Entwicklung des MPIfG, zunächst gemeinsam mit der Soziologin und Gründungsdirektorin Renate Mayntz, später mit dem 1995 berufenen Direktor Wolfgang Streeck. Scharpf gehört zu den international renommiertesten Politikwissenschaftlern und hat wesentlich zur Sichtbarkeit und Anerkennung des Faches beigetragen. Im Jahr 2000 erhielt er als erster Deutscher den prestigeträchtigen Johan-Skytte-Preis. Für seine Verdienste im Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis wurde er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Bis heute ist Fritz W. Scharpf am Kölner Institut wissenschaftlich aktiv. Seine aktuelle Forschung, angeregt durch die Eurokrise seit 2009, widmet sich der Geschichte und Zukunft der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.