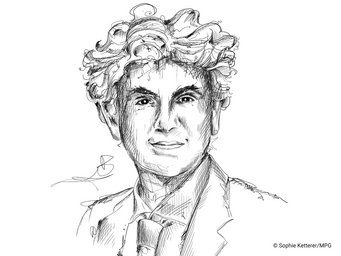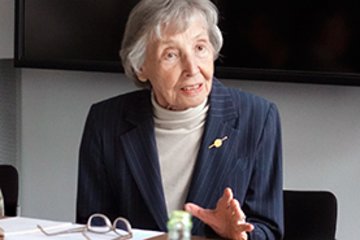Fünf Fragen zur Zukunft des US-Dollars als Weltleitwährung an Lucio Baccaro
Interview mit Lucio Baccaro
Kann die Trump-Politik den Status des US-Dollars als Weltleitwährung gefährden? Im Interview mit Elke Maier analysiert Lucio Baccaro die widersprüchlichen fiskalpolitischen Ziele der neuen US-Regierung und erklärt, warum weder Euro noch Yuan als Nachfolger infrage kommen, welche systemischen Risiken ein plötzlicher Vertrauensverlust bergen würde – und weshalb ein multipolares Währungssystem die Zukunft sein könnte.
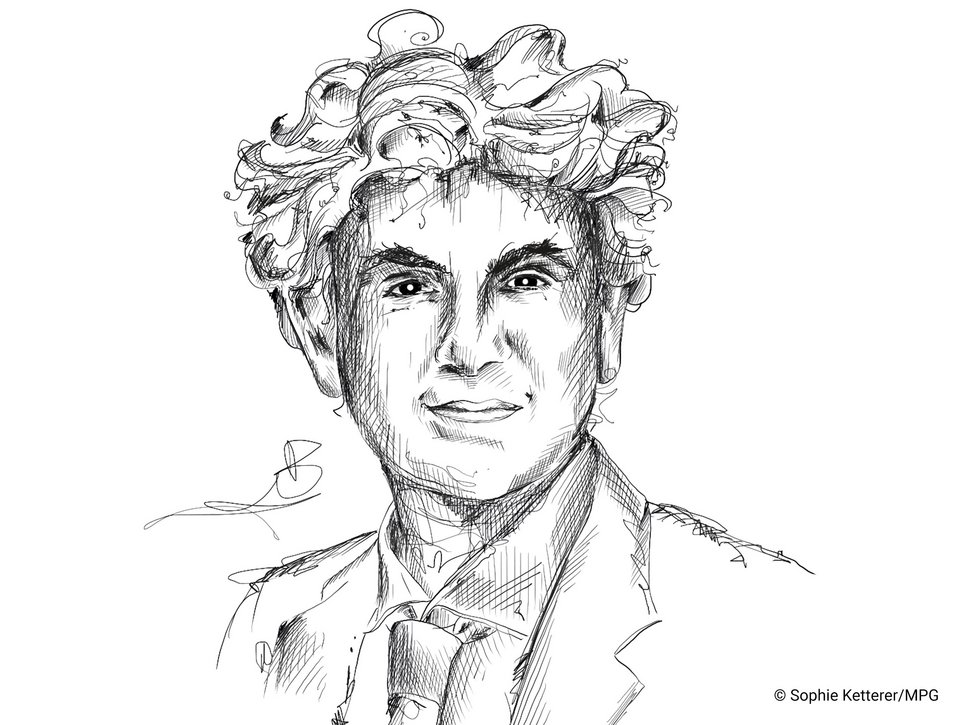
Das Interview führte Elke Maier.
Die USA stellen seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Weltleitwährung. Glauben Sie, dass der US-Dollar diesen Status verlieren könnte und dies das Ziel der Trump-Regierung ist?
LUCIO BACCARO: Obwohl der US-Dollar derzeit keinen ernsthaften Konkurrenten hat, könnte die politische Agenda der Trump-Regierung seine Grundlagen schwächen. Die US-Führung strebt eine Abwertung des Dollars an, um die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie wiederherzustellen. Gleichzeitig will sie den Reservestatus des US-Dollars erhalten. Um diese Ziele in Einklang zu bringen, setzt sie ihre Partnerländer unter Druck, damit die ihre Importe aus den USA erhöhen und einen finanziellen Beitrag zu den militärischen Sicherheitsgarantien der USA leisten. Das sogenannte Mar-a-Lago-Abkommen sieht vor, dass die Verbündeten kurzfristige Staatsanleihen gegen sehr langfristige US-Schulden mit niedriger Verzinsung – wie 100-jährige Staatsanleihen – eintauschen. Zölle oder die Drohung, militärischen Schutz durch die USA einzustellen, dienen als Druckmittel. Das Abkommen soll sicherstellen, dass die USA langfristig an „günstiges“ Geld gelangen.
Was sind die Folgen für die Weltwirtschaft, insbesondere Europa, wenn der US-Dollar schwächer wird?
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einer allmählichen Schwächung des US-Dollars und einem plötzlichen Vertrauensverlust in seinen Reservestatus. Letzteres wäre eine systemische Bedrohung: US-Staatsanleihen bilden das Rückgrat des internationalen Finanzsystems. Würden die Anleger diese Wertpapiere massenhaft ver- äußern, könnte dies zu einer weltweiten Liquiditätskrise führen. Europa bliebe davon nicht verschont: Europäische Banken sind in hohem Maße von Finanzierungen in US-Dollar abhängig. Eine allgemeine Flucht aus Dollar-Vermögenswerten auf der Suche nach sicheren Alternativen würde die Kreditbedingungen für die Banken verschärfen. Dies würde die Kredite für Unternehmen und Haushalte verteuern oder, schlimmer noch, zu Kreditsperren in riesigem Ausmaß führen, wie wir das während der globalen Finanzkrise gesehen haben.
Welche Währung könnte den US-Dollar ersetzen – auch der chinesische Yuan oder der Euro?
Der Yuan ist kein wahrscheinlicher Kandidat, vor allem, weil er nicht frei in andere Währungen konvertierbar ist und weiterhin Kapitalkontrollen durch die chinesischen Behörden unterliegt. Auch fehlt es an Transparenz und Berechenbarkeit. Der Euro könnte im Prinzip die Rolle als Weltleitwährung übernehmen, das würde jedoch von Europa eine grundlegend andere Wirtschaftspolitik und Wachstumsstrategie erfordern. Leitwährungen müssen durch sichere Vermögenswerte wie Staatsanleihen gestützt werden. Um die weltweite Nachfrage absorbieren zu können, wäre entweder eine groß angelegte Emission gemeinsamer Euro-Schulden nötig oder eine anhaltende Emission nationaler Staatsschulden − vor allem Deutschlands − durch Haushaltsdefizite.
Wäre es für Europa erstrebenswert, dass der Euro die Rolle als globale Leitwährung übernimmt?
Grundsätzlich ist die Ausgabe einer Weltleitwährung ein Privileg: Sie ermöglicht es dem Hegemonieland, sich über längere Zeiträume hinweg international zu verschulden, ohne dass die Zinssätze deutlich steigen. Dieses Privileg hat jedoch auch seine Schattenseiten. Eine hohe Nachfrage nach der Leitwährung erhöht tendenziell den Wechselkurs sowie die Preise von Vermögenswerten. Um Emittent der Weltleitwährung zu werden, müsste Europa seine Abhängigkeit von exportorientiertem Wachstum aufgeben und zu einem schulden- und konsumorientierten Modell übergehen, ähnlich dem der Vereinigten Staaten.
Könnte es künftig mehrere Leitwährungen nebeneinander geben?
Ja, das ist im Prinzip möglich und auch wünschenswert: Ein multipolares Währungssystem, in dem der US-Dollar, der Euro und möglicherweise der Yuan jeweils als Anker für verschiedene Einflusssphären dienen, könnte die globale Abhängigkeit von einer einzigen Leitwährung verringern und so- wohl die Vorteile als auch die Lasten gerechter verteilen.