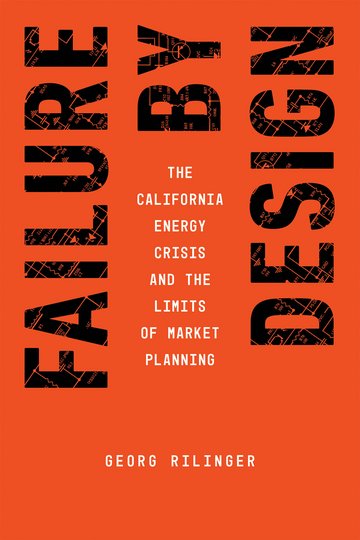Philip Manow
Professor für Vergleichende Politische Ökonomie an der Universität Bremen |
Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPIfG 1990–2000

Ich kam 1990, zur Wendezeit, an das Kölner MPIfG – aus dem Zentrum des historischen Geschehens, wenn man so will, nämlich Berlin, an den westlichsten Rand des nun vereinigten Deutschlands. Der Schock, den das mit sich brachte, war zunächst gar nicht so sehr ein intellektueller, denn während meines Studiums in Berlin hatte ich mehr und mehr Anschluss an das Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) gefunden, und das bereitete zumindest ansatzweise auf die Art von Sozialwissenschaft vor, die am Kölner MPIfG betrieben wurde. Der Schock war eigentlich eher einer der Lebensumstände. Wir waren als Kleinfamilie umgezogen, kamen zwar aus dem vergleichsweise rauen Neukölln, aber waren auf das, was uns im „sozialen Brennpunkt“ Köln Höhenberg erwartete, trotzdem nicht vorbereitet. Während der Zeit als Doktorand kam dann ein zweites Kind und danach auch noch ein drittes, und sowie es die Umstände erlaubten, flohen wir aus Köln ins Umland, wo wir bis heute glücklich und zufrieden leben.
Die beiden damaligen Direktoren, Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf, hatten mir eine Doktorandenstelle angeboten. Zu den prägenden Erinnerungen gehört natürlich das Vorstellungsgespräch im vierten Stock der Lothringer Straße, dem ersten Sitz des Instituts, und die zwei absoluten Respektspersonen auf dem schicken Ledersofa der klassischen Moderne – genauso wie die guten Antworten auf die guten Fragen, die einem ja immer erst im Nachhinein einfallen. Ich wurde trotzdem als Doktorand aufgenommen. Im Studium und dann auch in der Diplomarbeit hatte ich mich mit Gesundheitspolitik beschäftigt, und das Gesundheitssystem war einer der drei „staatsnahen Sektoren“, denen sich das erste Forschungsprogramm des Instituts besonders widmete. Mit Marian Döhler war kurz zuvor jemand mit den gleichen Forschungsinteressen aus Berlin nach Köln gewechselt. Ihn hatte ich noch kurz am WZB kennengelernt, und nun entwickelte sich ein sehr enger und sehr intensiver Austausch, der zu mehreren Aufsätzen und schließlich einem gemeinsamen Buch führte. Unvergessen hier ebenfalls der allerstrengste Rüffel aus dem Munde von Frau Mayntz bei einer der mittäglichen Espressorunden, wo wir denn bitteschön neben unseren eigentlichen Forschungsaufgaben – ich hatte schließlich eine Promotion über die Vereinigung der beiden deutschen Gesundheitswesen zu schreiben – die Zeit für alle diese „Nebentätigkeiten“ hernähmen? Es war wohl auch etwas im Spiel, was man heute Prokrastination nennt, denn aus meinem eigentlichen Promotionsthema ließen sich lange Zeit keine wirklichen intellektuellen Funken schlagen.
Nach der Promotion begann eine thematische Suchphase, die sich auch insofern komplex und riskant entwickelte, als 1995 Wolfgang Streeck als neuer Direktor an das Institut kam und sich mit ihm die Ausrichtung des Instituts veränderte. Würde in der neuen Forschungsagenda Platz für mich sein? Ja, es war. Auch hier ist mir das entscheidende Gespräch noch in Erinnerung: Als wir anfingen, über die Jungfrau des Kölner Dreigestirns als Beispiel für „das ausgeschlossene Dritte“ zu sprechen, verdichtete sich bei mir der Eindruck, dass wir uns verstehen würden. Das fügte sich auch deswegen, weil ich mittlerweile meine Fragestellungen erweitert hatte, weg von der Policy-Forschung, die ich schon immer für eine eher sterile Angelegenheit und disziplinäre Sackgasse gehalten hatte, hin zur Rekonstruktion längerfristiger institutioneller Entwicklungsdynamiken. Das ließ sich für allgemeinere Fragestellungen öffnen, etwa die nach der Einbettung des Sozialstaats in das Wirtschafts- und Wachstumsmodell entwickelter Industrieländer. Insofern war damit eine Schnittstelle zur Vergleichenden Politischen Ökonomie eröffnet und die Anknüpfung zu älteren Diskussionssträngen wie etwa der Neokorporatismusforschung möglich. Im Hintergrund wirkte und wirkt für mich bis heute Gerhard Lehmbruch als große intellektuelle Orientierungsfigur. Er war damals auch Mitglied im Fachbeirat des MPIfG.
Seitdem ist viel passiert. Es kam zur akademischen „Landverschickung“ – ein Jahr Center for European Studies, Cambridge Massachusetts – eine sehr harte und sehr lehrreiche Zeit, während der ich große Teile meiner Habilitation zu Papier gebracht habe. Thema war die Rolle des Bismarck’schen Wohlfahrtsstaates in der spezifisch deutschen Variante des Kapitalismus, von 1880 bis 1990. Das Buch ist nun gerade erschienen, nochmals stark überarbeitet – endlich, 19 Jahre (!) nach der Verteidigung der Habilitationsschrift an der Universität Konstanz. Es folgten Stationen in Konstanz als Assistent beim Soziologen und Politikwissenschaftler Jens Alber, zurück nach Köln als Forschungsgruppenleiter am MPIfG, dann zurück nach Konstanz auf meine erste Professur, dann nach Heidelberg, 2010 schließlich Bremen. Hier traf ich auf Uwe Schimank, Susanne K. Schmidt und damals noch Philipp Genschel, allesamt ehemalige MPIfG-Kolleginnen und -Kollegen.
»Das unfassbare Privileg einer Universitätsprofessur: Man wird für seine Neugierde bezahlt!«
Thematisch nahm ich zunehmend weniger Rücksichten auf disziplinäre Grenzen oder „angestammte“ Zuständigkeiten. Denn bei all den vielschichtigen und in ihrem Umfang stark gewachsenen Anforderungen an eine Universitätsprofessur, auf die das MPIfG dann doch nur wenig vorbereiten konnte, gehört ja zu ihrem eigentlich unfassbaren Grundprivileg weiterhin: Man wird für seine Neugierde bezahlt! Diese Neugierde erstreckt sich auf „von außen“ vielleicht manchmal etwas disparat erscheinende Themen: das deutsche Wahlsystem; die Rolle der Religion in der Formierung der Parteiensysteme Europas – und dadurch dann auch bei der Ausbildung spezifischer Politischer Ökonomien; die symbolische Repräsentation demokratischer Politik; die Europäische Integration; die Demokratietheorie. Da darf dann auch schon mal ein Aufsatz dabei sein, der beleuchtet, was die Wiederaufnahme des deutschen Walfangs im Jahre 1938 mit Carl Schmitts Land und Meer und seinem Nomos der Erde zu tun hat.
Würde ich auch nur beginnen, die Personen zu erwähnen, die in diesen letzten dreißig Jahren hilfreich, wichtig, lehrreich, herausfordernd, anregend, unterstützend als intellektuelle Rollenmodelle und so fort gewirkt haben oder weiterhin wirken, wäre das Format „Was macht eigentlich …?“ sofort gesprengt. Wie gut das MPIfG selbst funktioniert hat – über alle Ebenen hinweg (stellvertretend für viele: Susanne und Elke, Prog-Rocker Manuel, Jürgen, Gisela, Anne, Cynthia, Ernst …) – lässt sich immer wieder an dem hohen Ausmaß der Verbundenheit ersehen, das alle „Ehemaligen“ teilen, die gemeinsame Sprache, die man unweigerlich spricht, wenn man sich austauscht, und die Freude, mit der man sich anlässlich des Institutstages wiedersieht. Bei aller retrospektiver Idealisierung, zu der diese „Was macht eigentlich …?“-Prosaform neigt, sollte allerdings auch nicht verschwiegen werden, dass wir immer und jederzeit wirklich viel gearbeitet haben. Im Zentrum des katholischen Rheinlandes stand und steht ein Institut, das der protestantischen Arbeitsethik stark verpflichtet ist.